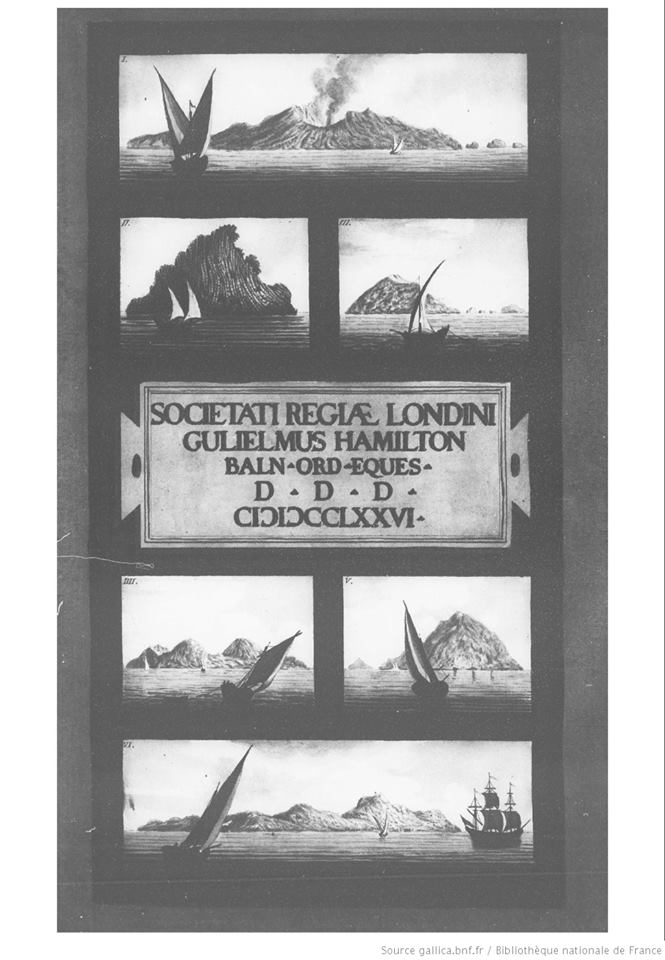In diesem gleichmütigen Leben ohne Morgen, das der kleinen Zeit keinerlei Wichtigkeit beimisst, lag – welche Lappalie für klägliche Blicke – das Besondere dieses in Spinnweben gehüllten Neapel, das keine Grenzen kennt. Die große Seele der Stadt wanderte von einer fernliegenden Zeit der Vergangenheit nach einer anderen, fern in der Zukunft liegenden; alles Kurzbemessene erschien ihr banal und erbärmlich. Es war schön, die ganze Leichtgläubigkeit einer Vorzeit zwischen den Fetzen der Wirklichkeit aufzuspüren. Inmitten der Asche die schwelende Glut allerältester Zeiten. In jener tremendistischen Stimmung lag das Tragische der Stadt; denn alle hätten eine Stadt, deren Fortbestehen gesichert war, für die augenblicklich Lebenden bauen wollen, mit anderen Worten, alle wollten länger leben, an den Punkt kommen, wo sie selbst das, was von ihnen kam, auskosten konnten. Wenn irgendeine Bitternis unter den Erhebungen dieser Stadt lag, so war es das Gefühl, nicht noch länger leben zu können. Man begriff dort, wie kurz das Leben doch war.

Solch eine unnachgiebige Verwurzelung, wie sie den unsterblichen Städten des Kosmos eigen ist, ließ Lorenzo über all die Tage, die man wie einen einzigen, ewigen Tag durchlebt, hinaussehen. Auf ihm bewegt sich der unerschöpfliche Vorrat an Maccheroni, endlos, wie aus Feldküchen eines Heeres kommend – Nahrung, die Kanonen ähnelt, wie aus unterirdischen Öfen, riesige Behälter von unbegreiflich dehnbaren Maccheroni.
Lorenzo spürte in diesem Neapel eine so wunderbare Kraft, daß man sich wie in der Zeit der Cholera fühlte, nur ohne Cholera. Die antiken Seuchen verliehen dem Leben mehr Leben, mehr Gültigkeit. Man vernimmt den uralten Peitschenhieb, der das Leben auskosten und stärker fühlen läßt. Die Tage Neapels atmen eine dunkle Drohung. Gleichgültigkeit vortäuschend, ist sich dennoch jeder ihrer bewußt. Daher fühlt man Ströme von Mitleid und Klagen durch die Straßen fluten…
Dieses Volk war von solcher Echtheit, daß es stets der Katastrophe entgegensah; das Meer, das Erdbeben, die dichte Wolke, die Cholera, an keinem anderen Ort finden die Stätten der Toten ähnliche Vorbereitung. Daher zündet jeder sein Licht vor dem Heiligenbild an; sie wollen bereit sein.
Ramon Gomez de la Serna, 1927
Ramón Gómez de la Serna (geb. 1888 in Madrid; gest. 1963 in Buenos Aires) war ein spanischer Schriftsteller. Große Bekanntheit erreichte der von ihm gegründete literarische Stammtisch im Café Pombo in Madrid. Bis 1931, das Jahr in dem er nach Buenos Aires zieht, lebt de la Serna in Madrid mit häufigen Ausfenthalten in der Schweiz, Neapel, Florenz, London, Lissabon und Paris. Nach seinem Tod im Jahr 1963 in Buenos Aires wird sein Leichnam nach Madrid überführt und im Panteón de Hombres Ilustres beigesetzt.
Ramón Gómez de la Serna beschreibt ein Lebensgefühl der Stadt Neapel, das subjektiv ist, in Neapel aber nicht selten auch von sensiblen Schriftstellern in esoterischen Formen beschrieben wurde. Nicht selten wird der Stadt Neapel eine schwierige aber besondere Atmosphäre zugesprochen, vielleicht auch durch die Größe des historischen Teils der Stadt oder den großen Differenzen innerhalb Neapels bevorzugt, die einen gewissen Teil der Besucher immer wieder überrascht und fasziniert. Ein besonderer Hinweis von Ramón Gómez de la Serna gebührt somit auch, neben dem Gefühl der Ewigkeit und der Vergänglichkeit, dem Bezug der neapolitanischen Bevölkerung zum Tod, der auch heute noch an den vielen Hausaltaren mit Bildern an und in den neapolitanischen Palazzi oder besonderen Kultstätten wie dem Fontanelle-Friedhof nachzuempfinden ist.
Weitere Berichte und Zitate über Neapel und die Region findet ihr in meinem Blog.